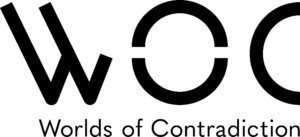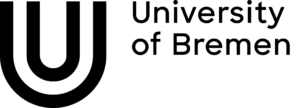Angesichts der jüngsten Verhaftungswelle gegen Politikerinnen und Politiker der größten Oppositionspartei CHP einschließlich dem berühmten Oberbürgermeister Ekrem Imamoğlu und die darauffolgenden Massendemonstrationen im ganzen Land, wird in der Türkei die Frage, ob das Regime Erdoğans nun von einem kompetitiven in einen vollständigen Autoritarismus umschlägt, heiß diskutiert. Bislang konnte die CHP mit ihrem Vorsitzender Özgür Özel die Proteste erfolgreich organisieren. Die Drohung Präsident Erdoğans, die Stadtverwaltung Istanbuls und die CHP selbst unter Zwangsverwaltung zu stellen, konnten sie erfolgreich abwenden. Eine Freilassung ihrer wichtigen Vertreter zu erreichen, ist ihnen aber nicht gelungen. Zunehmend ist davon die Rede, dass die Wahlen in Zukunft abgeschafft werden könnten und Erdoğan dadurch nicht mehr abwählbar ist. Das folgende Gespräch mit Ulrike Flader gibt zu diesen und ähnlichen Fragen einige Antworten.
Dr. Ulrike Flader ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaften der Universität Bremen und beobachtet seit vielen Jahren die politischen Entwicklungen in der Türkei als Mitglied der Forschungsgruppe „Soft Authoritarianisms“.
Das Interview führte Dr. Çetin Gürer, Sozial- und Politikwissenschafter und Assoziierter am InIIS, Universität Bremen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Konflikt- und Friedensforschung, Pluralismus und Autonomiemodellen, die Kurdische Frage sowie Politik und Gesellschaft der Türkei. Er promovierte mit einer Arbeit zur Lösung des Kurdischen Konflikts in der Türkei an der Universität Ankara und publiziert als Kommentator regelmäßig zu aktuellen Fragen in der Türkei.
Die Abwählbarkeit Erdoğans ist eine Fiktion
Dr. Çetin Gürer: Wir möchten heute über das autoritäre Regime Erdoğans und die jüngsten Entwicklungen in der Türkei sprechen. Der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, wurde verhaftet und viele Beobachter nun behaupten, dass das Regime Erdoğans dadurch von einem kompetitiven zu einem vollständigen Autoritarismus übergeht. Stimmt dies Deiner Meinung nach? Kann man jetzt schon von einem vollständigen Autoritarismus in der Türkei sprechen?
Dr. Ulrike Flader: Das kann man jetzt noch nicht ganz sagen. Es wird sich noch zeigen. Denn jeder Autoritarismus kann sich natürlich noch verschärfen und es gibt keinen Grund, warum Erdoğan ganz davon befreit wäre, zu einem vollkommenen Diktator sozusagen zu werden. Aber meinen Beobachtungen zufolge geschieht gerade das, was wir jetzt beobachten, tatsächlich wieder nur, weil er sich die Wahlen sichern will. Das spricht eher dafür, dass alles, was er momentan tut, immer noch ein Taktieren ist innerhalb das, was wir – als Forschungsgruppe – Soft Authoritarianism, also ‚sanften‘ Autoritarismus, nennen. Das heißt nicht, dass es kein Autoritarismus ist. Der Regierungsstil Erdoğans ist schon seit einer ganze Weile Autoritarismus, aber ‚soft‘ Autoritarismus ist eben eine spezifische Form von Autoritarismus.
Çetin Gürer: Kannst Du das bisschen mehr erläutern? Wieso meinst Du, es ist schon eine ganze Weile Autoritarismus gewesen? Heißt das, die Verhaftung Imamoğlus ist keine neue Entwicklung?
Ulrike Flader: Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass die CHP jetzt argumentiert, dass nun endgültig klar ist, dass man Erdoğan nicht mehr abwählen kann; also, dass das Erdoğan-Regime nicht durch Wahlen beendet werden kann. Meiner Meinung nach ist dies aber schon die ganze Zeit klar gewesen, also seit den Wahlen im Juni 2015, in denen die HDP, d.h. die kurdisch-linke Partei, etwa 13% der Stimmen gewann und dadurch Erdoğan die Mehrheit verlor. Da hat Erdoğan zum ersten Mal genau diesen taktischen Schritt gemacht hat, die Wahlen nicht anzuerkennen und Neuwahlen ausgerufen, und in der Zwischenzeit den Krieg gegen die Kurden angefacht, so dass die Ultra-Rechten mit ihm Koalieren, was sie vorher nicht wollen.
Also das war ja schon ein autoritärer Schritt und zeigte eigentlich damals schon, dass Erdoğan alles tun wird, um seine Macht zu erhalten und dass er nicht einfach abwählbar ist und durch Wahlen geht. Und ich glaube, das hat sich eigentlich momentan auch nicht geändert, auch wenn die CHP die letzten Jahre immer gehofft hat, dass sie ihn per Wahlen abwählen können. Meiner Meinung nach war das schon die ganze Zeit eine Fiktion und genau damit spielt in dieses soft autoritäre Regime.
Dieses Regime funktioniert eben genau dadurch, dass durch die Wahlen eine Fiktion der Abwählbarkeit aufrechterhalten wird. Es gehört zu meinem Verständnis von soft Autoritarismus dazu, dass die CHP die ganze Zeit geglaubt hat, dass sie tatsächlich durch Wahlen irgendwann drankommen werden.
Çetin Gürer: Aber es war nicht nur die CHP, auch andere Oppositionelle haben auch immer daran geglaubt, dass Erdoğan durch Wahlen abgewählt werden könnte.
Ulrike Flader: Natürlich werden Wahlen auch noch von Oppositionsparteien gewonnen, wie im Fall der Kommunalwahlen in vielen Orten geschehen, wo z.B. in Istanbul mit Ekrem Imamoğlu und in Ankara mit Mansur Yavas Kandidaten der CHP gewählt wurden oder in vielen Städten und Gemeinden in den Kurdischen Gebieten. Gerade weil in so einem Regime die Wahlen noch aufrecht gehalten werden, bleibt paradoxerweise immer eine winzige Möglichkeit der Abwählbarkeit. Es ist nie total ausgeschlossen – eben deshalb kein Totalitarismus. Nur lässt sich daraus nicht einfach schließen, dass das Regime insgesamt tatsächlich per Wahlen beendet werden kann. Das ist ein Schein. Da gehört mehr dazu als nur Wahlen. Sonst könnte man auch immer noch von einer illiberalen oder schlecht-funktionierenden Demokratie sprechen – da gibt es auch viele verschiedene Definition.
Çetin Gürer: Jetzt verstehe ich Dich also so, dass die Festnahme von Imamoğlus in dem Sinne keine Wende oder keinen Übergang zu einem vollständigen Autoritarismus bedeutet. Erdoğan bleibt immer noch beim soften oder kompetitiven Autoritarismus. Das ist weiterhin der Charakterzug von seinem Regime. Ist das richtig?
Ulrike Flader: Genau. Levitsky & Way formulieren meines Erachtens – wenn sie von kompetitiven Autoritarismus sprechen – dass „the playing field“ zwischen Opposition und Regierungspartei sowieso „uneven“ ist.
Çetin Gürer: Was ist damit gemeint?
Ulrike Flader: Also, dass das Feld, in dem die Parteien um die Macht konkurrieren, ungleich ist. Das macht es sehr schwer, dass das der Machthaber abgewählt werden kann. Sie beschreiben die vielfältigen Mittel, mit denen die oppositionellen Politikerinnen und Politiker behindert werden, dazu zählen Inhaftierungen, sie ins Exil treiben, sogar Mord.
Aber worauf ich hinauswollte ist, dass gerade in der Forschung, die ich betreibe, für mich von Anfang an diese affektive Ebene auch zentral ist. Ich bin ja Anthropologin. Mich interessiert vielleicht etwas anderes als Politolog:innen. Wir gucken uns natürlich auch die politischen und legalen Praktiken an. Aber für mich war immer interessant auch wie gerade Oppositionelle in der Türkei reagieren und da war seit Jahren ganz eindeutig ein Wechselspiel zwischen Apathie und Hoffnung zu erkennen. Man hat richtig gesehen, dass jedes Mal, wenn es Wahlen gab, Menschen – egal wie überzeugt sie davon waren, dass es gar keine Demokratie in der Türkei gibt – haben dennoch dafür gearbeitet, dass sie die Wahlen gewinnen. Das hat auf eine Art und Weise mit ihren Gefühlen gespielt. Das ist sehr klug. Ein Regime, was es schafft dich irgendwie in einem solchen Modus zu halten, dass du – obwohl du denkst alles so schlecht – trotzdem zur Wahl gehst oder Dich in den Wahlen engagierst und Hoffnung hast, aber es eigentlich nur eine Fiktion ist. Dieses Spiel mit deinen Gefühlen ist Teil dieses Regimes, meiner Meinung nach.
Çetin Gürer: Diese Hoffnung zu schaffen ist auch eine Taktik oder Strategie von Erdoğans Regime. Dass viele trotz allem daran glauben wollen, dass die Demokratie, Wahlen und demokratische Instanzen so einiger Maßen funktionieren, ist eine Fiktion.
“Auch wenn man erkennt was für eine autoritäre Situation das ist, zieht es einen hinein, weil es ein Versprechen auf eine Chance zur Veränderung ist. Diese Möglichkeit kannst du nicht einfach so übergehen. Als Oppositionelle:r musst du diese Chance ergreifen, auch wenn sie noch so klein ist”
Ulrike Flader: Richtig. Ich würde fast sagen, dass wenn total klar wäre, dass nichts mehr möglich wäre, dann würden die Menschen ja andere Gegenstrategien wählen, würden andere Widerstandsformen finden. Aus der Perspektive der Macht gesehen ist es total schlau. Das ist eine Art von Management. So, nenne ich das auch: ein Management der Opposition. Ich weiß, dass die Menschen das sogar alles erkennen und trotzdem hat das so eine Macht über einem, weil diese Hoffnung, dass es potenziell möglich wäre, das Regime zu ändern, so machtvoll ist – auch wenn man noch so reflektiert ist. Auch wenn man erkennt was für eine autoritäre Situation das ist, zieht es einen hinein, weil es ein Versprechen auf eine Chance ist. Diese Möglichkeit kannst du nicht einfach so übergehen. Als Oppositionelle:r musst du diese Chance ergreifen, auch wenn sie noch so klein ist und Erdoğan vielleicht doch am Ende einen anderen Ausweg findet. Darüber kann man natürlich noch viel reden, aber zurück zu deiner Frage, ob Erdoğan jetzt zu einer vollständigen Autokratie übergeht.
Es kann natürlich sein. Es gibt bestimmte Anzeichen dafür, dass Erdoğan am Ende seines Taktiktieres ist. Ein soft autoritäres Regime muss bestimmte Spielräume zum Taktiktieren haben, um dem Autokraten den Gewinn der Wahlen sichern können. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass Erdoğan taktiert. Es gibt kein totales Verbot von Parteien. Es gibt kein totales Verbot von Medien. Stattdessen gibt es immer so ein Taktiktieren, wie jetzt zum Beispiel: ein Sendeverbot für bestimmte Kanäle für 2 Wochen oder 10 Tage. Das ist aus meiner Sicht ein sehr typisches Beispiel von dieser neuen Form von Autoritarismus – von mir aus können wir auch diskutieren ob es vielleicht auch faschistische Elemente hat. Aber ich denke noch ist Autoritarismus der bessere Begriff.
Dieses kurzzeitig machen und zurücknehmen, dieses Hin-und-Her, kann aus meiner Sicht – das ist der Punkt, den ich vorhin machen wollte – diese Art zu regieren viel langlebiger und nachhaltiger machen, als vielleicht ein vollständiger Autoritarismus.
Lieber ‚softer‘ Autokrat als Diktator
Çetin Gürer: Früher hatte Erdoğan mehr als 50% der Bevölkerung hinter sich. Aber jetzt kann er sich nicht mehr sicher sein, die Wahlen zu gewinnen. Tickt ein Minderheiten-Autoritarismus vielleicht anders als ein Mehrheitsautoritarismus? Könnte es sein, dass er als ein Minderheitsautokrat die Wahlen nicht mehr stattfinden lässt.
Ulrike Flader: Das ist der Grund warum ich sage, es gibt bestimmte Anzeichen. Eines davon ist, ob er überhaupt noch Spielräume zum Taktieren bei den Wahlen hat. Weil – egal ob man von kompetitiven Autoritarismus spricht oder einen anderen Begriff verwendet – Wahlen sind immer noch zentral. Auch Erdoğan muss irgendwie noch halbwegs plausibel zeigen können, dass er die Mehrheit hat. Aber dafür muss der Autokrat noch taktieren können.
Das ist jetzt genau die Frage: was kann Erdoğan jetzt noch machen? Er hat bereits an den Wahlbezirken gefeilt. Er hat den Obersten Wahlrat (Yüksek Seçim Kurulu) unter Druck gesetzt. Er kann natürlich noch ein bisschen Wahlmanipulation machen. Er kann vor den Wahlen alle Pressekanäle für sich dominieren, wie er es immer gemacht hat. Er kann das Militär in bestimmten Provinzen rausfahren, so dass die Menschen daran gehindert werden an den Wahlen teilzunehmen. Er kann Gewalt einsetzen. Aber irgendwann ist auch da eine Grenze. Irgendwann reichen diese Mittel nicht mehr, Mehrheiten zu erzeugen.
Bei den letzten Wahlen, zum Beispiel, konnte er sich noch hinstellen und sagen, es ist ein „Fest der Demokratie“ (Demokrasi Şöleni). Warum konnte er das sagen? Es ist natürlich interessant, dass er das sagt. Aber hier ist noch wichtiger, dass er es noch sagen kann. Weil es am Ende wirklich so aussah als ob er ganz demokratisch gewonnen hatte.
“Das Hin-und-Her, Maßnahmen durchzuführen und sie wieder zurücknehmen, macht diese Art zu regieren viel langlebiger und nachhaltiger”
Und jetzt um auf deine Frage zurück zu kommen: wenn er keine Spielräume mehr für diese Manipulationen hat, dann muss er irgendwann aufhören diese Wahlen stattfinden zu lassen. Aber meiner Meinung nach gibt es da immer noch ein paar Stufen, bevor er die Wahlen ganz abschafft und endgültig zu einer Diktatur übergeht. Ich meine die Hürden dafür sind für Erdoğan immer noch relativ hoch: Die Türkei ist immer noch in die globalen Weltgemeinschaft eingebunden, ist NATO-Mitglied, hat Beziehungen zur EU und so weiter. Also da gibt es sehr viele Hürden, warum er lieber ein ‚soft‘ Autokrat bleiben würde als totaler Diktator. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist zum Beispiel dass die Gewalt zunimmt und dass er einen Aufnahmezustand ausrufen könnte oder er nochmal solche Taktiken auffährt wie die Wahlen vorziehen oder vorübergehend aussetzen, oder – vielleicht sprechen wir gleich nochmal drüber – die Möglichkeiten ausschöpft, die sich jetzt aus einer erneuten Annäherung mit den Kurden ergeben.
Einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen, der in eine neue Richtung führt, aber auch ein Argument dafür ist, dass es sich meiner Meinung nach momentan noch nicht um Übergang zu einem vollständigen Autoritarismus handelt. Es ist nämlich sehr interessant, dass Erdoğan momentan gerade bei der CHP und ihren Anhängern eine andere Politik fährt und parallel mit den Kurden Friedensgespräche führt und er potenziell in diese Richtung irgendwelche demokratischen Schritte unternehmen könnte – auch wenn es im Moment noch nicht wirklich danach aussieht. Dadurch gibt es wieder eine Hintertür für ihn, wodurch er wieder keinen totalisierenden Schritt macht, sondern sich gegenüber den unterschiedlichen Bevölkerungsteilen anders verhält und dadurch immer noch ein Element an Pseudodemokratie hält.
Soft Authoritarianism: Ein Listiges Regieren mit Widersprüchen
Cetin Gürer: Magst Du nun Euer Konzept von Soft Authoritarianism nochmal mehr erläutern?
Ulrike Flader: Ja, ich habe es schon etwas angedeutet. Erstmal ist soft autoritär ja ein widersprüchlicher Begriff. Da fragt man sich sofort wie kann Autoritarismus überhaupt soft sein? Es ist wie ein Widerspruch in sich. Und das ist gerade was wir versuchen aufzuzeigen. Erstmal handelt es sich bei soft Autoritarismus um eine hybride Regierungsform. Das heißt, es sieht immer noch formell aus wie eine Demokratie, ist aber ganz klar Autoritarismus. Um das nochmal zu unterstreichen: wir sagen eben nicht, dass es eine illiberale Demokratie ist oder sowas ähnliches. Wir halten nicht an dem Demokratiebegriff fest, sondern benennen es ganz klar als autoritär. Zweitens ist wichtig, dass ‘soft’ auf gar keinen Fall heißen soll, dass es keine Gewalt gibt. Das ist eine der Hauptfragen, die aufkommen. Der Begriff soll tatsächlich etwas ‘provokativ’ sein oder besser gesagt, zum Nachdenken anregen. Gerade wenn man sich mit der Türkei beschäftigt, und als eine Person, die sich lange mit der Gewaltgeschichte gegenüber den Kurden auseinandergesetzt hat, wäre es völlig absurd die Gewaltförmigkeit dieser Regierung – mit den Ausgangsperren und Kämpfen in 2015, den Inhaftierungen kurdischer Politikerinnen und Politiker und den Bombardierungen von Nordostsyrien – zu leugnen. Ich würde sogar behaupten, dass das Anfachten der Gewalt gegenüber den Kurden nach der verlorenen Wahl von 2015 eine ganz zentrale Bedeutung in der autoritären Transformation hatte. Und das war pure, ganz brutale Gewalt. Von daher: ‚soft‘ soll auf gar keinen Fall gewaltfrei bedeuten. Der Begriff abzielt vielmehr auf die Flexibilität dieser staatlichen Praktiken ab, auf das Taktiken, das Spielen, auch das Arbeiten mit Widersprüchen, die immer wieder täuschen und die Anfänge nicht leicht erkennbar machen.
„Der Begriff zielt vielmehr auf die Flexibilität dieser staatlichen Praktiken ab, auf das Taktiken, das Spielen, auch das Arbeiten mit Widersprüchen, die immer wieder täuschen und die Anfänge nicht leicht erkennbar machen.“
Es gibt sehr viele Beispiele, woran man erkennen kann, dass die Regierung irgendwas Autoritäres macht was aber gleichzeitig wie eine demokratische oder herkömmliche legale Regelung daherkommt. Nicht ohne Grund benötigt man legale Vorwände, wie die Imamoğlu vorgeworfene Veruntreuung von Geldern, als Grund die politischen Gegner hinter Gitter zu bekommen. Oder Steuerregelungen, um die Arbeit von kritischen NGOs zu erschweren. Ich nehme auch immer gerne das Beispiel der OHAL-Kommission (Kommission zur Prüfung der Dekrete im Ausnahmezustand), weil diese Kommission ganz offiziell ein Mittel war, um den Weg zu einem Gerichtsverfahren wieder zu eröffnen. Die Personen, die per Dekret entlassen worden waren, hatten nämlich keine Möglichkeit, Widerspruch innerhalb des Justizsystems einzulegen, weil ihre Fälle dort nicht behandelt wurden. Daraufhin hat sogar das Europäische Gericht für Menschenrechte, der Türkei aufgetragen eine Lösung zu finden, die daraufhin diese Kommission gegründet. Die Kommission öffnete paradoxerweise den Weg zu Gerechtigkeit, während sie gleichzeitig ein autoritäres Machtinstrument war, weil sie gar keine unabhängige Überprüfung der Fälle gewährleisten sollte und weil die Menschen durch dieses Verfahren zum Teil acht oder mehr Jahre in Warteposition gehalten wurden. Dieses Doppelspiel – das ist bezeichnend für dieses Regime. Es arbeitet absichtlich, man könnte sagen auf listige Weise, mit dem inhärenten Widerspruch. Und das ist deshalb so interessant, weil es nämlich bedeutet, dass es demzufolge gar keinen Sinn macht, Widersprüche aufzudecken. Aus einer marxistischen Lesart heraus entsteht ja Widerstand aus der Erkennung und dem Aufzeigen von Widersprüchen.
Çetin Gürer: Und das funktioniert gar nicht mehr.
Ulrike Flader: Genau. Auch wenn man sich Trump anguckt und diese ganz Post-Truth Debatte. Eigentlich ist es nicht nur ein populistisches Element, dass es nicht mehr oder nur schwer möglich ist postfaktischen Argumente anzufechten, sondern es gilt für die gesamte Regierungsweise. Diese Form von soft autoritärer Regierung funktioniert die ganze Zeit damit, dass es die Widersprüchlichkeiten in sich vereint, so dass du nicht auf sie zeigen kannst und dann bricht das System zusammen.
Çetin Gürer: Das heißt die Widersprüche gehören dann zu der Logik dieser Art der Regierung. Sie dienen Erdoğan, sich selbst an der Macht zu halten. Er muss sich selbst nicht für sie rechtfertigen. Die Hauptsache ist, dass es Widersprüche sind, die man nicht mehr mit normaler Vernunft und Logik lösen kann. Viele Widersprüche machen dieses Regime nicht funktionsunfähig, sondern ganz im Gegenteil.
Ulrike Flader: Ja. Üblicherweise würde man denken, dass Autoritarismus eigentlich “gradlinig” sein müsste. Zumindest verweisen viele Menschen noch immer verärgert darauf, dass Erdoğan sich hier oder da widersprochen hat. Und dass obwohl sehr viele Menschen genau wissen, was ich hier beschreibe, wenn sie im Alltag davon sprechen “aklımızla oynuyor” [Er spielt mit unserer Vernunft]. Das habe ich wirklich von sehr vielen verschiedenen Menschen gehört. Es kommt den Menschen vor wie eine schiere Verrücktheit, Madness. Aber diese Madness hat Methode. Diese Methode gehört meiner Meinung nach zu diesem Regierungsstil. Ich würde aber jetzt nicht sagen, je mehr Widersprüche, desto besser.
Çetin Gürer: Aber es ist ihm egal, also ob das Regierungshandeln widersprüchlich erscheint oder nicht, weil er sich nicht dafür rechtfertigen muss, bzw. er gar nicht das Ziel hat, politisch korrekt zu sein.
Ulrike Flader: Für mich ist es sogar etwas zweitrangig mit welchem Bewusstsein dies eingesetzt wird. Hier ist erstmal wichtig, dass Regierungspraktiken mit dieser Gleichzeitigkeit von Widersprüchlichem arbeiten.
Çetin Gürer: Beispielsweise führen sie einen Lösungsprozess mit Kurden, während sie die demokratisch gewählten kurdischen Bürgermeister absetzen. All das passiert gleichzeitig.
Ulrike Flader: Zum Beispiel. Allein ein autoritäres Regime, was nach außen hin als Demokratie gibt, ist ja schon ein Widerspruch in sich. Aber auch auf der kleinen Ebene sieht man immer wieder, wie genau dies gemacht wird. Immer sieht eine Maßnahme oder Prozess vordergründig irgendwie demokratisch aus, ist aber tatsächlich autoritär. Ein bekanntes Beispiel ist auch wie die letzte Regierung in Polen das Rentenalter von Richtern runtergesetzt hat, um die vakanten Positionen mit partei-loyalen Richtern zu besetzen. Oder erinnern wir uns wie die Verfassung in der Türkei zuletzt geändert wurde. Darin wurden die die Befugnisse des Präsidenten massiv ausgeweitet und die des Parlaments eingeschränkt, während gleichzeitig aber die Zahl der Parlamentsabgeordneten erhöht und die Alter für das passive Wahlrecht herabgesetzt wurde. Das sind zwei Schritte, die auf dem ersten Blick erst mal pro-demokratisch erscheinen können, sind sie aber eben nicht.