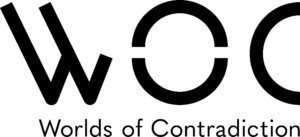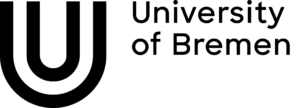Zum „sanften“ Autoritarismus in der Türkei. Die strategische und flexible Verflechtung von demokratischen und nicht-demokratischen Praktiken ist ein Charakterzug ‚sanfter‘ Formen autoritärer Regierung. Ein Verständnis von der Produktion von Affekten wie Apathie und Hoffnung in diesem Zusammenhang kann uns helfen, ihre Funktionsweise und gesellschaftlichen Effekte aus einer Alltagsperspektive besser zu greifen.
Zum ersten Mal seit Jahren verbreitet sich momentan eine gewisse Hoffnung in Teilen der Opposition: Hoffnung auf ein Ende der Ära Erdoğan; auf einen Machtwechsel bei den Parlamentsund Präsidentschaftswahlen 2023; auf eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie. Schlagzeilen über Amtsmissbrauch und Begünstigungen im Zusammenhang mit regierungsnahen Vereinen in Mitten der anhaltenden wirtschaftlichen Krise geben der parlamentarischen Opposition einen solchen Aufwind, dass der Vorsitzende der republikanischen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, vor Kurzem sogar die Beamten aufforderte, die „Komplizenschaft“ in diesen Machenschaften zu verweigern. Doch kann die Offenlegung dieser Skandale wirklich das Regime zu Fall bringen? Ist nicht schon längst bekannt, auf welche Weise die Regierung ihr nahestehende Unternehmen und Organisationen privilegiert und sich ihre Unterstützung sichert, und sogar mit mafiösen Strukturen verwickelt ist? Auch wenn die Dimension dieser Machenschaften so manchen noch empört, wird dies allein sicherlich nicht reichen, um das Regime ins Wanken zu bringen. Denn das Vereinigen von Widersprüchen ist charakteristisch für diese Form der Regierung.
„Sanfter“ Autoritarismus
Crony capitalism ist nur ein Aspekt dieser Art von Regierung, die wir als Bremer Forschungsgruppe um Prof. Dr. Shalini Randeria als soft authoritarian bezeichnen. Diese Regime sind demokratisch gewählt und ziehen ihre Kraft sogar ganz besonders aus Wahlen, höhlen jedoch – in strategischer aber „sanfter“ Weise – die demokratischen Strukturen von innen aus. Dafür wird die Verfassung geändert, wie in der Türkei mit dem Referendum von 2017, das den Wechsel von parlamentarischer zur Präsidialdemokratie besiegelte; das Wahlrecht den eigenen Interessen angepasst – zumeist durch Gerrymandering, d.h. die Änderung der Wahlkreise gemäß den errechneten Wahlchancen, die direkte Wahlfälschung fast obsolet macht. Auch dies ist in verschiedener Weise in der Türkei geschehen. Außerdem gehört dazu die Übernahme oppositioneller Medien zum Teil durch direkte Schließung und Beschlagnahme ihrer Einrichtungen oder durch andere kreative Wege. Allem voran steht jedoch die Umstrukturierung der legalen Architektur des Staates und des Justizwesens, um die Unabhängigkeit zu unterbinden und treue Personen in zentrale Positionen zu hieven. Dabei werden auch Straftatbestände ausgeweitet, um politische Gegner in Schach zu halten. Darüber hinaus nutzte die türkische Regierung das ihr durch den gescheiterten Putschversuch in die Hände gelegte Instrument des Ausnahmezustands und der damit einhergehenden Gesetzgebung. Obwohl kein Novum – bedenkt man den jahrzehntelangen Ausnahmezustand, der über den Putsch von 1980 hinaus noch bis 2002 in den mehrheitlich kurdischen Gebieten verhängt wurde – hatte dieser landesweite Ausnahmezustand sehr gravierende Folgen für verschiedene gesellschaftliche Kräfte. Auch die bereits angelaufenen Verhandlungen für eine friedliche Beendigung des Kurdenkonflikts wurden diesem Kalkül untergeordnet und stattdessen Krieg und Gewalt als Mittel gegen die politischen Gegner im Inund Ausland gewählt.
Listig und Flexibel
Angesichts dieser gewaltvollen Repression mag es verwundern, dass wir dennoch den Begriff des „sanften“ Autoritarismus verwenden. Als „sanft“ verstehen wir hier nicht die Abwesenheit von Repression, sondern die strategische Gleichzeitigkeit und Verflechtung von autoritären und demokratischen Praktiken. In pragmatischer Weise werden scheinbar widersprüchliche Praktiken zu einer „listigen“ Form des Regierens (Randeria) kombiniert. John Keane verweist dabei darauf, dass diese Regime keine Zwischenstadien von Demokratien auf ihrem Weg zu vollendeten Autokratien sind, sondern als spezifische Form der Regierung verstanden werden müssen. Sie zeichnen sich durch eine „Flexibilität“ aus, die im Fall der Türkei es dem Regime ermöglicht, scheinbare „Kurskorrekturen“ vorzunehmen, wie mit der für diesen Dezember angekündigten erneuten Änderung der Verfassung, die unter anderem die Rechenschaftspflicht der Minister:innen gegenüber dem Parlament wieder stärken soll. Revisionsverfahren gehen unerwartet „positiv“ aus und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden umgesetzt, wenn es politisch opportun ist. Diese Praktiken allein als Verschleierung „eigentlicher“, autoritärer Interessen zu verstehen, verkennt die Logik der „sanft“ autoritären Regierungsform und unterschätzt ihre Anpassungsfähigkeit und potentielle Langlebigkeit.
Die Werte liberaler Demokratie werden austauschbar, Wahrheit und Vernunft verlieren ihre ihre Verankerung.
Listig ist diese Form der Regierung, weil die Architektur der Demokratie, die Institutionen und Prozedere weiterhin aufrechterhalten werden, aber vom Inhalt völlig entleert werden. Dies ermöglicht der Regierung sich völlig selbstverständlich auf die Rechtsstaatlichkeit zu beziehen, wie Erdoğan selbst immer wieder tut. Keane nennt dies mimicry of democracy. Andrea Pető hingegen beschreibt dies als ein „Aussaugen“ der staatlichen Institutionen, welche nur noch als opportunity structures behandelt werden, um für das eigene Klientel Ressourcen abzuzweigen und Machtpositionen zu sichern. Dabei werden sie als leere Hüllen zurückgelassen, was ihr zufolge zu einem Verfall demokratischer Ideale, Normen und Prozesse führt, oder wie es Wendy Brown formuliert, die Werte liberaler Demokratie „austauschbar“ werden lässt und Wahrheit und Vernunft „ihre Verankerung“ verlieren. Beiden geht es darum, dass es sich um Praktiken handelt, die den vorhandenen Strukturen ihren eigentlichen demokratischen Kern oder Wesen entziehen. Die Hülle bleibt; der Kern ist fort.
Produktion von Apathie muss als affektives Management der Opposition verstanden werden.
Was bedeutet es aber, wenn die demokratische Architektur nicht nur als Gerüst eines Prozederes verstanden wird, sondern auch für ein Versprechen steht, das immer wieder angerufen werden kann und sogar von der Opposition angerufen werden muss, gerade dann, wenn alle anderen Wege öffentlicher Auseinandersetzung versperrt sind? Dieser Widerspruch zwischen dem Vorhandensein einer demokratischen Architektur und der gleichzeitigen Entleerung von ihrem Inhalt hat weitreichende Auswirkungen auf die Opposition und die lebendige Zivilgesellschaft, die in der Türkei existiert(e). Unter anderem scheint er – so meine vorläufige These –, eine Form der Apathie zu produzieren, die die Entfaltung gesellschaftlicher Opposition und Kritik in einer Weise behindert, die über direkte Repression hinausgeht. Bereits Juan Linz betont, dass Autoritarismus, anders als Totalitarismus, nicht auf einer enthusiastischen Teilnahme der Bevölkerung aufbaut, sondern Apathie produziert. Apathie verstehe ich nicht im Sinne von Politikverdrossenheit und Desinteresse, sondern als einen durch Regierungspraktiken aktiv produzierten affektiven Zustand, der Handlungsunfähigkeit suggeriert. So sprechen meine Interviewpartner:innen von Gefühlen der „Lethargie“ (bezginlik) und Erschöpfung (bitkinlik). Andere berichten von einer Ermüdung durch die ständige Beschäftigung mit scheinbar sinnlosen Maßnahmen und Äußerungen der Regierung. Produziert werden diese affektiven Zustände durch die spezifische Willkür und den toxischen Schwebezustand der orchestrierten Gleichzeitigkeit von Demokratischem und Nicht-Demokratischem. Sie erschweren nicht nur die Fähigkeit, Unrecht auszudrücken, sondern auch es überhaupt erst wahrzunehmen und darauf zu reagieren, und führen so zu einer Normalisierung des Unrechts. In diesem Sinne muss die Produktion von Apathie als affektives Management der Opposition verstanden werden.
Hoffnung als Kehrseite der Apathie?
In diesem Zustand der Quasi-Ohnmacht zeigt sich die Hoffnung nicht nur im Hinblick auf einen möglichen Machtwechsel bei den Wahlen, sondern auch in Spekulationen über den geistigen und physischen Gesundheitszustand des Präsidenten. Das Interpretieren seines Einnickens während Interviews, sein schleppendes Laufen oder das Ablesen vom Teleprompter sind zum Sinnbild der Hoffnung geworden. Diese hoffnungsvolle Stimmung kann sicherlich der Apathie etwas entgegensetzen. Dennoch hat die Flexibilität des „sanften“ autoritären Regierungsstils in den vergangenen Jahren schon diverse Krisenmomente zugunsten Erdoğans ausgehen lassen. Dass für diesen Dezember auch eine Änderung des Wahlrechts und ein Gesetz zu „Desund Missinformation in den sozialen Medien“ angekündigt worden ist, lässt wenig Gutes hoffen. Unter diesen Bedingungen erscheint dieses Hoffen daher nur noch als ein unbestimmtes Warten und damit als Kehrseite der Apathie. Die Frage ist jedoch nicht, ob die Hoffnung realistisch oder utopisch ist. Vielmehr bietet ein Verständnis von Affekten wie Hoffnung und Apathie Erkenntnisse über die Funktionsund Wirkungsweise dieser „sanften“ Formen autoritärer Regierung, die über ihren institutionellen Rahmen hinausgehen.
This article from the IWM Post has been republished with the kind permission of the Institute of Human Sciences (IWM) in Vienna.